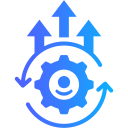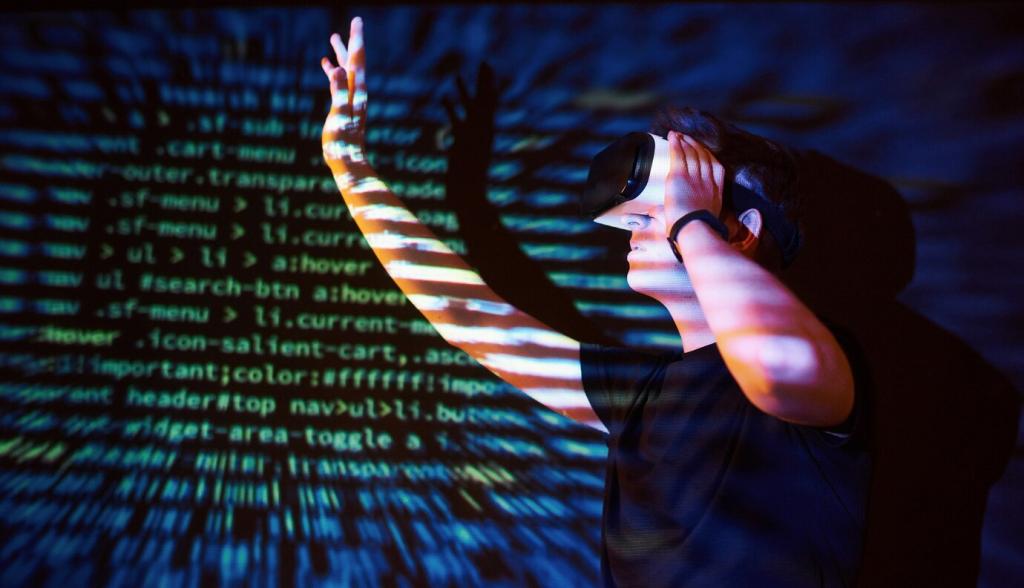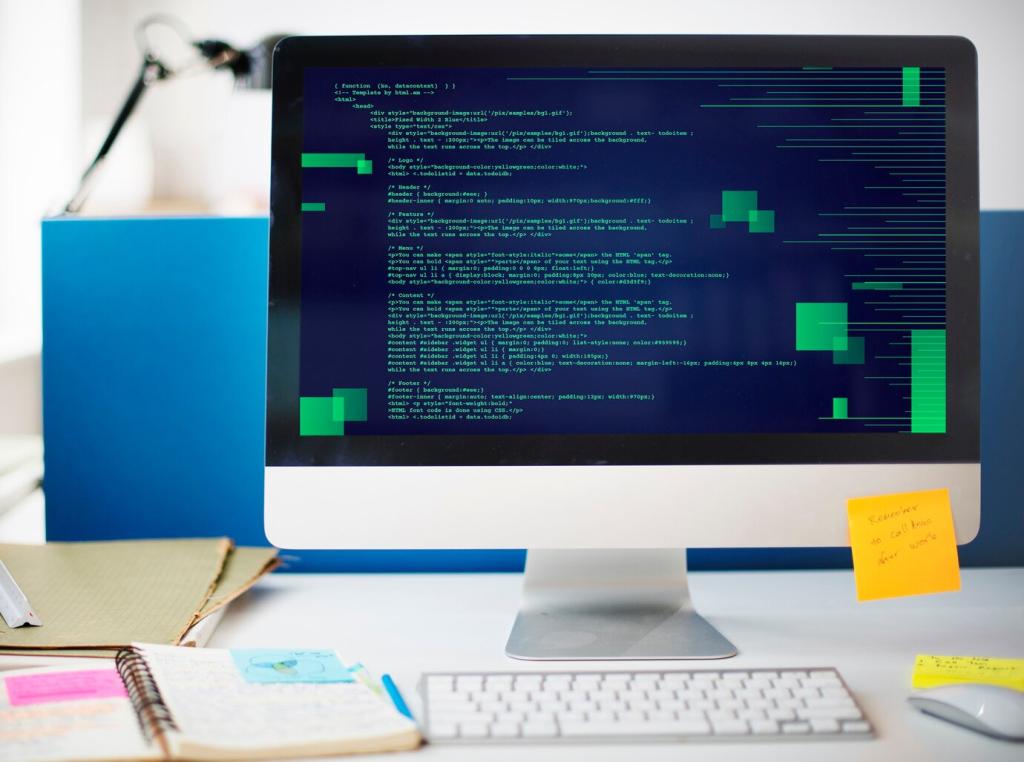Governance, Sicherheit und Kontrolle
Definiere Datenquellen, Zugriffsrechte und Klassifizierungen früh. Low‑Code erleichtert zentrale Policies und Versionierung, No‑Code profitiert von freigegebenen, kuratierten Konnektoren. Gemeinsame Kataloge vermeiden Schattenkopien und schaffen Vertrauen in Berichte und Automatisierungen.
Governance, Sicherheit und Kontrolle
Regulatorik endet nicht bei Code. Log‑Pflichten, Audit‑Trails und Aufbewahrungsfristen müssen auch in No‑Code‑Flows gelten. Low‑Code‑Pipelines erlauben Prüfungen und Scans. Schulungen helfen Fachbereichen, Datenschutz und Zweckbindung praktisch umzusetzen.